Von Frauenmilchsammelstellen, Babys an der Fensterscheibe und Mamas, die ihr Kind erst 24 Stunden später wieder sahen – Interview mit Christina Meyer, Kinderschwester in der ehemaligen DDR
Vor wenigen Wochen hatte meine Leserin Anke mir geschrieben, was sie von ihrer Schwiegermutter und anderen Frauen dieser Generation über die Praxis in Entbindungskliniken in der DDR kurz vor der Wende gehört hatte (https://www.wer-ist-eigentlich-dran-mit-katzenklo.de/2018/08/nach-der-geburt-eingepackt-und-weggebracht/). Anke war so fasziniert von diesem Thema, dass sie weiter recherchiert hat und schließlich ein Interview mit einer Bekannten geführt hat, die vor der Wende Kinderschwester auf einer Neugeborenen-Station war. Sehr bewegt lauschte ich diesen Aufzeichnungen auf einer meiner Zugfahrten zwischen München und Hamburg und beschloss, das Interview auf meinem Blog zu veröffentlichen. Hier ist es. Ein Zeitdokument!

ANKE: Christina, Sie haben in den 70er und 80er Jahren als Kinderschwester auf einer Entbindungsstation in einer Klinik im Erzgebirge gearbeitet. Gab es damals in der DDR „Rooming-in“, also, dass das Baby nach der Geburt bei seiner Mutter bleiben konnte?
CHRISTINA: Nein, das gab es damals in der DDR noch nicht oder selten. Jedenfalls wurde in unserer Einrichtung „Rooming-in“ erst nach der Wende eingeführt. Und es war auch nicht so, dass der Vater bei der Geburt dabei sein konnte.
ANKE: War das gar nicht möglich?
CHRISTINA: In unserer Klinik war das bis zur Wende nicht möglich. Aber bei meiner Freundin konnte bereits 1981 und 1983 der Ehemann bei der Geburt dabei sein. In der Frauenklinik, wo sie entbunden hat, war das möglich, wenn es die räumlichen Gegebenheiten zuließen, das heißt, wenn keine weitere Geburt in diesem Kreißsaal anstand. Allerdings hat sie sehr bedauert, dass die Kinder auch dort nach der Geburt nicht bei der Mutter bleiben konnten. Wahrscheinlich war es überall ähnlich wie in meiner Klinik, dass das Neugeborene nach der Erstversorgung im Kreißsaal auf die Säuglingsstation kam. Dort wurde es von einer Kinderschwester aufgenommen und in ein vorgewärmtes Bettchen gelegt.

Auf der Kinderstation bekam es auch sofort seinen roten SV-Ausweis (Sozialversichungs- und Impfausweis) ausgestellt, welcher das Kind bis ins Jugendalter begleitete und alle wichtigen gesundheitlichen Daten enthielt. An jedem Bettchen stand ein DIN A3 großer Pappdeckel mit einem Formular, der sogenannten Kurve. Darauf wurden an jedem Tag Eintragungen gemacht, welche das Kind betrafen z.B. Temperatur, Gewicht, Nahrung und Stuhlgang. Wenn der Vater erfuhr, dass das Kind da ist, konnte er zuerst seine Frau besuchen und ist dann zum Kinderzimmer gegangen. Da hat er geklingelt, es wurde die Gardine zur Seite gezogen und er bekam sein Kind gezeigt. Durch die Scheibe durch.
Dann wurde auf die Kurve, die an dem Bettchen hing oder stand, ein Häkchen gemacht. Das bedeutete: der Vater hat das Kind gesehen.
ANKE: Das heißt, er durfte es in den sieben Tagen, in denen die Wöchnerinnen damals üblicherweise in der Klinik waren, nur dieses eine Mal sehen?
CHRISTINA: Ja, er durfte es eigentlich nicht ein zweites Mal sehen. Und wenn er dann mit der Oma kam, vielleicht auch noch mit den Schwiegereltern, alle, die sich auf das Kind gefreut haben, dann war das Häkchen ja schon dran. Da hieß es: Sie haben das Kind ja schon gesehen.
ANKE: Gab es dafür eine Begründung?
CHRISTINA: Es hieß, wir reißen die Kleinen nicht noch einmal raus aus dem Bettchen. Auch wenn die gerade gar nicht geschlafen haben und es auch nicht gestört hätte. Auch Kinder durften generell nicht auf die Station. Geschwisterkinder freuen sich ja ebenfalls monatelang auf das Baby. Und wenn sie das Geschwisterchen endlich sehen wollten, ging das in der Klinik nicht. Ich habe mich immer furchtbar geschämt, wenn es geklingelt hat draußen und es war damals so ein ungeschriebenes Gesetz, die Jüngere, die mit im Dienst war, hat an die Tür zu gehen. Dann war ich diejenige, die dem Vater oder den Großeltern erklären musste, die manchmal auch von weit her kamen und voller Vorfreude waren, dass das Kind nicht gezeigt wird. Da habe ich mich wirklich geschämt wie sonstwas.
ANKE: Ist mal jemand auf die Idee gekommen zu sagen, ich will das jetzt aber trotzdem?
CHRISTINA: Ja, wir haben das schon versucht, aber das wurde abgelehnt, weil es Vorschrift war und auch Schwestern dabei waren, die damit ihre Macht demonstrieren wollten. Wenn wir jungen Schwestern alleine Dienst hatten und Bekannte kamen, haben wir manchmal die Kinder heimlich nochmal gezeigt.
Einmal habe ich gegen die Vorschrift verstoßen. Das war so: Die Kinder wurden vor dem Stillen aufgeladen auf so eine lange Gondel, auf der ca. zwölf Kinder passten. Wir hatten meist zwei solcher Wagen, auf denen die Säuglinge wie die Ölsardinen lagen. Den Wagen habe ich vom Kinderzimmer zu den Mütterzimmern gefahren, vorbei an einer Tür zum Treppenhaus. Hinter dieser Glastür stand ein Kind, ein Geschwisterkind, das auf seinen Vati gewartet hat. Ich bin nur ein bisschen langsamer mit dem Wagen gefahren, habe kurz angehalten und habe dem Kind gezeigt, welches das Geschwisterchen ist. Das hat eine Kollegin gesehen und hat gesagt, du weißt doch gar nicht, wo das Kind herkommt und ob es vielleicht eine Infektion hat, und sie hat mich beim Chef angezeigt. Als ich bei ihm vorgeladen wurde, war er aber ganz nett, hat den Zeigefinger gehoben und hat gesagt: Ich schimpfe jetzt mal mit Ihnen und mache mal „dududu“. Der hat das also zum Glück nicht so ernst genommen.
ANKE: Nochmal zurück zu dem Moment direkt nach der Geburt. Wie war das genau?
CHRISTINA: Da wurden die Kinder nicht direkt angelegt. Sie wurden der Mutter kurz gezeigt und dann von der Hebamme abgesaugt, gebadet, gemessen, gewogen, gewickelt und die Augenprophylaxe gemacht. Die Kinder bekamen ein Armbändchen mit dem Namen der Mutter. Außerdem kam noch ein Heftpflaster mit dem Namen auf die Brust (auf das Jüpchen*). Das war ganz wichtig, damit die Mutter später auch sicher sein konnte, dass sie wirklich ihr eigenes Kind bekommt. Wenn das Neugeborene eingepackt und bei der Mutter alles ok war, wurde ihr das Kind nochmal für ein paar Minuten in den Arm gelegt. Dann ging es ab ins Kinderzimmer, wo es von den Säuglingsschwestern weiter versorgt wurde. Als Nahrung gab es in den ersten Stunden Glukose. Das war Fencheltee mit Traubenzucker. In unserer Einrichtung war das so. Ein ganz süßer Tee. Den gab es alle vier Stunden 10g-weise. Erst nach 24-Stunden wurden die Kinder wieder zur Mutter gebracht und angelegt.
ANKE: Warum hat man so lange gewartet? Das war ja eine wahnsinnig lange Zeit bis zum ersten Anlegen.
CHRISTINA: Ja, aus heutiger Sicht total verkehrt. Es hieß, da müsste sich der Magen erst dran gewöhnen oder irgend so ein Blödsinn. Die Kinder haben den süßen Tee oft ausgebrochen. Und das Verrückte war, du musstest ja alle 20 Kinder damit füttern. Der nächste Blödsinn war, dass wir sie immer gewogen haben, bevor sie zum Stillen zur Mutter gefahren wurden. Danach wurden sie wieder eingesammelt und wieder gewogen und geguckt, was haben sie denn jetzt getrunken. Die vorgeschriebene Trinkmenge wurde jeden Tag um 10g pro Mahlzeit gesteigert – also 20g, 30g, 40g, 50g u.s.w. Und was da gefehlt hat, das wurde nachgefüttert. Die Trinkmengen wurden in einem Heft dokumentiert. Damit konnten wir den Muttis auch Auskunft geben, ob und wieviel ihr Kind getrunken hat. Hatten Sie genug getrunken, waren die Muttis stolz und glücklich, aber wenn es nicht ausgereicht hat, waren sie traurig und enttäuscht.
ANKE: Womit wurde nachgefüttert?
CHRISTINA: Mit Muttermilch. Wir hatten eine Frauenmilchsammelstelle im Haus, in der die Muttermilch gesammelt wurde. In der ganzen Umgebung gab es Frauen, die Spenderinnen waren. Mein Opa war Fahrer im Krankenhaus und hat die Milch bei den Frauen abgeholt. Der war eigentlich Müller. Aber als die Mühle schließen musste, hat er als Fahrer im Krankenhaus angefangen. Da hat er eine Ärztin gefahren zu Hausbesuchen, ist für die Blutbank gefahren und eben seine Milchtouren. Die hat er geliebt, weil die Frauen schon gewartet haben mit nem Kaffee und alles schon vorbereitet hatten. Das war für ihn das Schönste vom ganzen Tag, wenn er seine Milchtour hatte.
ANKE: Wie wurde die Spender-Milch genutzt?
CHRISTINA: Sie wurde besonders für die Ernährung der Frühgeborenen genutzt und da die Sammelstelle bei uns im Hause war, hatten wir immer einen Vorrat zum Nachfüttern. Sie wurde im Fläschchen erwärmt und dem Kind verabreicht, wenn es bei der Mutter nicht genug getrunken hatte. Das hat eine Weile gedauert, bis wir mit allen durch waren, mit Wiegen und nachfüttern. Und wenn die Babys das nächste Mal zur Mutter gekommen sind, konnte es sein, dass sie gar nicht trinken wollten, weil sie erst vorher nachgefüttert worden waren. Das mit dem Stillen war schon verrückt, zumal die erste Milch ja sehr wertvoll ist. Die Milchsammelstelle allerdings, die war schon gut, vor allem wegen der Frühgeborenen oder kranken Säuglingen, welche die Milch bei Bedarf erhielten. Das war schade, dass die nach der Wende abgeschafft wurde.
Ich selber habe mich einmal im Nachtdienst bei besagter Glukosezubereitung mit kochendem Wasser verbrüht. Da habe ich eine Windel mit kalter Frauenmilch getränkt und mir um den Arm gewickelt. Sofort spürte ich, wie der Schmerz nachließ und es ist nichts zurückgeblieben. Ich glaube Muttermilch ist ein wahres Wundermittel.
ANKE: Und wie war das mit dem ersten Anlegen? Wurden die Mütter beim Stillen unterstützt?
CHRISTINA: Ja, das schon. Wenn das Kind zur Mutter gebracht wurde, haben sich die Frauen auf die Seite gedreht, welche gerade dran war, denn es wurde im Wechsel gestillt. Da wurde erst einmal die Bettdecke schön glatt gestrichen und das Kind draufgelegt. Es durfte nicht mit unter die Decke wegen dem Wochenfluss, so hieß es immer. Dann gingen wir Schwestern von Zimmer zu Zimmer und haben den Müttern geholfen. Anschließend wurde die Brust nachkontrolliert, ob alle Milch raus war. Wenn nicht, wurde noch mit der Handpumpe der Rest abgepumpt. Wenn es schwer ging, sagten wir manchmal im Scherz: “ Na, da müssen wir wohl mal die „Elektrische“ holen. Wir ahnten nicht, dass es nach der Wende tatsächlich elektrische Milchpumpen gab, die das erleichterten. Das mit der Handpumpe tat manchmal sehr weh, wenn jemand einen Milchstau hatte und die Brust ganz hart war. Alle Frauen trugen einen Still-BH in den eine sterilsierte Windel eingelegt wurde. Das war ein ganz schönes Gebachse (Sächsisch für Gewurschtel).
ANKE: Bis wie lange vor der Wende hat man das in der DDR so streng gehandhabt auf den Entbindungsstationen?
CHRISTINA: Ich kann nicht genau sagen, wann sich das ein bisschen gedreht hat. Aber Mitte der 80-iger Jahre wurde bei uns eine Vaterstunde eingeführt. Vor dem Stillen von ca. 17:00 bis 18:00 Uhr wurden die Kinder zur Mutter gebracht und der Vati kam zu Besuch. Das „Rooming-in“ war in unserer Klinik erst nach der Wende möglich. Unsere Stationsschwester ist gleich Anfang 1990 zu einem mehrwöchigen Lehrgang nach Fürth gefahren. Dort hat sie ausrangierte Babybettchen organisiert, welche an die Mütterbetten gehängt werden konnten. Das war die Grundlage für das „Rooming-in“ auf unserer Entbindungsstation.
Ich sage immer, es ging von einem Extrem ins andere. Nach der Wende sprang plötzlich jeder im Wöchnerinnen-Zimmer herum. Da hat eine Mutti stillen wollen und die andere hatte gerade fünf Mann zu Besuch. Da musste ich denken, das kann jetzt auch nicht richtig sein. Das Stillen finde ich, bedeutet nicht nur den Hunger stillen, sondern sollte auch eine stille, innige Zeit für Mutter und Kind sein. Und dafür einen Rhythmus zu finden, ist ja auch für die Mutter schön.
Den 4-stündigen Rhythmus und die Nachtpause fand ich schon gut – nachts wurde in der Klinik ja gar nicht gestillt. Wenn die Mutter Glück hatte und nach sieben Tagen heimging – hatten sich die Kinder schon etwas an daran gewöhnt und es kam auch vor, dass eines durchschlief (Naja mit sehr viel Glück).
ANKE: Was haben Sie gedacht, als Ihre Tochter für die Geburt ihrer Kinder vor wenigen Jahren einen ganz anderen Weg gewählt hat, als Sie das beruflich praktiziert haben, und für die Entbindung Ihrer Enkelin in ein Geburtshaus gegangen ist?
CHRISTINA: Ich habe mich sehr über sie gewundert, was sie für eine Einstellung dazu hat. Da hat sie gesagt: Mutti, willst du mal mitgehen ins Geburtshaus? Das habe ich gemacht und da war ich sehr angenehm überrascht. Ich hatte gedacht, es ist so ein bissel muschebubu (Sächsisch für schummrig), also alternativ oder esoterisch. Ich bin im Nachhinein überzeugt, dass das Geburtshaus genau richtig für sie war, obwohl sie gleich nach der Geburt zum Nähen in die Klinik musste. Dort hätte sie vielleicht das Kind nicht auf natürlichem Weg geboren. Meine Enkelin hat ja verkehrt gelegen. Sie war ein „Sterngucker“. Die Hebammen im Geburtshaus haben meiner Tochter Mut und Selbstvertrauen geschenkt, so dass die Geburt für sie trotz einiger Probleme ein positives Erlebnis geblieben ist. Heutzutage werden ja im Verhältnis zu früher sehr viel Kaiserschnitte gemacht. Das hat sicher vielerlei Gründe – aber es wundert mich schon.
ANKE: Nochmal zurück zu Ihrer Zeit als Kinderschwester. Wie war die Arbeit aufgeteilt zwischen Hebammen und Schwestern?
CHRISTINA: Damals war es streng getrennt zwischen Hebammen und Kinderschwestern. Die Hebamme war für die Geburt zuständig, für die Erstversorgung des Neugeborenen und natürlich für die Mutter nach der Entbindung. Die Kinderschwestern haben sich um die Kinder gekümmert, um das Stillen und die Brustpflege. Außerdem haben wir den Ärzten bei den Untersuchungen und beim Impfen assistiert. Die Kinderärztin kam immer zur Erstuntersuchung und die Kinder bekamen auch schon ihre erste Impfung. Da wurde niemand gefragt. Außerdem kam die Orthopädin regelmäßig und hat alle Kinder untersucht. Bei kleinen Fehlstellungen an Hüften oder Füßchen wurden schon erste Maßnahmen eingeleitet, zB. breit wickeln mit Spreizeinlage, spezielle Lagerungen oder Massagen, welche wir dann den Müttern gezeigt haben. Manchmal hat die Orthopädin auch schon ein Klumpfüßchen eingegipst.
Dann gab es da noch die Fürsorgerinnen. Die kamen etwa einmal die Woche und haben den Müttern die Säuglingspflege anhand einer Puppe demonstriert und sie z.B. bezüglich Ernährung und anderer Dinge beraten. Die Fürsorgerinnen haben die Mütter dann auch zu Hause besucht – so ähnlich wie es heute die Hebammen tun.
Das sogenannte „Vorbaden“ haben wir Kinderschwestern übernommen. Da wurde den Muttis, die das erste Kind hatten, das Baden anhand eines Babys gezeigt. Später, also Mitte der 80-iger Jahre, als wir auf die Entbindungsstation im neuen Anbau gezogen sind, hatten wir ein schönes Extrazimmer mit Wickeltisch und Wanne. Dort konnten die Mütter (vorzugsweise die das erste Kind hatten) einmal ihr eigenes Kind baden. Da haben sie zum ersten Mal ihr Kind nackt gesehen. Wir haben ihnen gezeigt, wie man es in der Wanne hält, wie man wickelt bzw. windelt u.s.w. Die meisten Mütter waren sehr dankbar dafür. Sie waren ja auch viel jünger als heutzutage – meistens so um die 20 Jahre beim ersten Kind.
Auf die Kinderpflege insgesamt wurde auf unserer Säuglingsstation sehr viel Wert gelegt. Da wurde gebadet, geölt, gecremt und gestriegelt, wenn auf dem Kopf schon ein paar Härchen waren. Für den Pops hatten wir eine sehr gute Kindersalbe, welche in der Apotheke eigens für unsere Station angerührt wurde. Die Käseschmiere wurde gleich nach der Geburt oder bei der Aufnahme auf der Kinderstation runtergerumpelt. Ansonsten wurden nach dem Baden zumindest die Hautfalten eingeölt. Manchmal haben das die Kleinen gar nicht so gut vertragen. So habe ich das zumindest empfunden. Einige sahen danach aus wie Krebse, so rot. Gerade der Simon, mein Sohn mit seinen roten Haaren, den habe ich nur gepudert. Das war eben so.
Neben dem täglichen Baden war das Wickeln (Windeln) vor den Mahlzeiten unsere Aufgabe. Dazu gehörte auch, die gute Beobachtung der Kinder hinsichtlich Stuhlgang, Erbrechen, Temperatur oder Hautzustand (zB. Neugeborenengelbsucht, Austrocknung u.ä.) Die Mutter musste indes warten, bis die vier Stunden um waren und ihr Kind endlich wieder zum Stillen gebracht wurde.
ANKE: War das auch so bei Ihnen in der Klinik, dass die Mütter die Windeln gefaltet haben in der Zeit, in der sie gewartet haben?
CHRISTINA: Ja, das haben sie manchmal gemacht – ich denke sogar gerne. Es gab ein Zimmer, da standen die Säcke mit den Windeln und bei dieser Arbeit ging es oft lustig zu. Auch die Hemdchen und Jüpchen mussten sortiert und zusammengelegt werden. Wir hatten eine Kollegin, die hat gerne Handarbeiten gemacht. Damit nicht alles so weiß aussah, hat sie die Jüpchen liebevoll bestickt. Später als es Strampler gab, hat sie auch schöne Schühchen für die Kleinen gehäkelt und gestrickt. Und sie hat sehr schöne Fotos gemacht. Das gab es auch zu DDR-Zeiten, dass wir die Neugeborenen fotografiert haben. Das war meist die Aufgabe einer Schwester im Spätdienst. Zur Entlassung haben dann die Eltern eine Karte mit Bild bekommen, auf der stand folgender Spruch von Goethe: “ Krone des Leben – Glück ohne Ruh – Liebe bist du“ und „Liebe Mutter! Wir wünschen Dir und Deinem Kind, dem Sinn und der Krönung Deines Lebens für die Zukunft alles Gute.“ Vom Vater war darauf keine Rede. Wenn du aber heute die Bilder siehst, ist es alles das Gleiche, immer die gleiche Wachstuchdecke mit kleinen Streublümchen drauf. Das war nicht schlecht. Ich finde die Fotos waren gar nicht so übel, nicht so verkitscht und übertrieben, wie heute manchmal alles ist.
ANKE: Heute sagt man ja, gar nicht mehr jeden Tag baden.
CHRISTINA: Ja, das war damals anders. Kinderbaden war eine unserer täglichen Hauptaufgaben – irgendwie verrückt – man hat es auch zu Hause weiter so gemacht. Dabei hatte ich das Gefühl, dass den Kindern das Baden gefällt, es ihnen gut tut und sie danach schön schlafen.
Meine Tochter hat mir erzählt, dass ihre Hebamme empfohlen hat, das Baby in der ersten Woche gar nicht zu baden. Das würde nie wieder so gut riechen, wie in dieser Zeit. Ich habe ein bisschen gelästert, weil ich dachte: Was soll denn an dem Kind nach der Geburt gut riechen? Aber sie hat wirklich gut gerochen. Da habe ich zu meiner Tochter gesagt: mein ganzes Berufsbild bricht in sich zusammen. Ich glaube, ich habe damals alles falsch gemacht. Das Baden war unsere Hauptarbeit. Alles für die Katz! (lacht) Aber über mein duftendes Enkelchen habe ich ein kleines Gedicht gemacht und das geht so:
Rosa
Du kleiner Märzenbecher, du rosa Schmetterling,
was bist du für ein Wunder, ein wunderbares Ding.Gleich zauberst du bei jedem ein Lächeln ins Gesicht,
der zärtlich dich berührt hat und leise mit dir spricht.So wie ein Himmelschlüssel in weicher Frühlingsluft,
machst du uns warm und glücklich mit deinem rosa Duft.(Rosa wurde im Frühling 2014 geboren)
ANKE: Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich klar macht, mein ganzes Berufsbild bricht zusammen?
CHRISTINA: Ganz so sehe ich es nicht. Es war auch etwas scherzhaft gemeint. Ich denke, das ist schon immer so gewesen, dass es Regeln und Erkenntnisse gab, die später wieder über den Haufen geschmissen wurden. Um so wichtiger ist es, allen Erkenntnissen und Regeln zum Trotz auf sein eigenes Bauchgefühl oder Herz zu hören. Ich sage nicht, dass alles richtig war, was wir gemacht haben. Und vielleicht war für manche Mutti diese Zeit nach der Geburt, die ja eigentlich eine schöne Zeit ist, eher schwierig. Trotzdem haben wir unsere Arbeit gern getan, waren freundlich und haben Mut gemacht. Noch heute, nach so vielen Jahren sprechen mich Leute darauf an.
Ich sage immer : „Zu viel und zu wing (wenig) – das ist ein Ding!“ Denn in der heutigen Konsum- und Mediengesellschaft ist es sicher auch nicht einfach, den richtigen Weg zu finden. Bei der Flut an Informationen durch das allgegenwärtige Handy und Gegoogle ist es heute eine Herausforderung für junge Frauen, sich die ureigenen mütterlichen Instinkte und Gefühle zu bewahren.
An dieser Stelle möchte ich den Hebammen des Geburtshauses Chemnitz danken, die meine Tochter vor, während und nach der Geburt begleitet und ihr mütterliches Selbstvertrauen gestärkt haben. Leider muss das Geburtshaus immer wieder um seine Existenz bangen.
Unsere kleine Entbindungsstation musste bedauerlicherweise vor zwei Jahren im Zuge der allgemeinen Rationalisierung schließen.
ENDE
Interview: Anke Kirsten
Abschrift und Bearbeitung: Uta Allgaier (Bitte alle an das Copyright denken! Nicht ohne unsere Erlaubnis kopieren und verwenden!)
Liebe Frau Meyer, Sie hatten mir in einer Mail geschrieben „Ich habe in den letzten Tagen ziemlich in der Vergangenheit gegraben und bin ganz aufgewühlt.“ Danke, dass Sie für uns noch einmal in die 80er der DDR abgetaucht sind und sich Ihren Erinnerungen gestellt haben. Danke, dass ich Ihr Gespräch mit Anke veröffentlichen durfte.
Und dir, liebe Anke, vielen Dank, dass du mich auf dieses Thema gebracht hast und uns alle teilhaben lässt an deinen Recherchen und vielen Dank für deine Arbeit!
Immer fröhlich allen danken, die sich über die Jahrzehnte dafür eingesetzt haben, dass wir unsere Kinder nach der Geburt bei uns haben dürfen, und danke all den Frauen, die sich an Stelle der Mamas liebevoll um Neugeborene gekümmert haben,
eure Uta
* Jüpchen = Hemdchen, das auf dem Rücken zugebunden wird
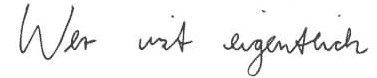



Hallo,
kinderlos und ohne DDR Hintergrund möchte ich doch gerne einen Gedanken anregen… bei allen Frauen, die dieses Interview -genau wie mich- bedrückt!
Falls Ihr Kuhmilch oder Butter, Käse etc. konsumiert: habt Ihr schon einmal eine Kuh herzzerreißend schreien hören, deren Kälbchen direkt nach der Geburt weggebracht wird?
Und nein: Tiermilchprodukte sind nicht gesund für den Menschen – ganz im Gegenteil. Wir sind ja auch keine Kuhbabies.
Einfach mal sacken lassen!
Liebe Grüße
Nina
Ich bin lange immer wieder zu diesem Beitrag gegangen und wieder raus. Ich bin selbst so auf die Welt gekommen und glaube, dass das nie wieder gut zu machen ist. Mir geht das Interview so nah, ich finde es immer noch schlimm, was damals als richtig angesehen wurde (und teilweise leider heute immer noch). Ich verstehe die Mütter, die Väter und auch die Schwestern, man wusste es nicht besser oder hatte kaum bis keine Möglichkeiten, etwas an der Situation zu verändern. Trotzdem glaube ich, dass es etwas mit diesen Babys gemacht hat. Und mit den Müttern.
Ich bitte um Entschuldigung für meinen wirren Text aber ich merke, dass er einen ganz fiesen Punkt in mir berührt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Interview soll trösten oder zumindest beruhigen? Oder versteh ich das alles falsch? Mich wühlt es auf und bewirkt eher das Gegenteil. Wobei ich es gut finde, schwarz auf weiß zu lesen, dass es tatsächlich so gelaufen ist und nicht nur ein diffuses Gefühl ist.
Liebe verwirrte Grüße
Dana
Liebe Dana, danke, dass du dich mit dem Interview auseinandergesetzt und geschrieben hast, obwohl es dich so traurig gestimmt hat.
Zunächst möchte ich vorausschicken, wie froh ich bin, dass Eltern und Babys während und nach der Geburt heute so sehr viel mehr Nähe und Zuwendung erfahren. Und ich möchte in keiner Weise schön reden, was noch in den 80er Jahren in der DDR üblich war und bis in die 70er Jahre im Westen. Auch meine Schwestern und ich sind von unserer Mutter getrennt und nur zum Stillen gebracht worden. Das betrifft auch im Westen mehrere Generationen.
Gleichwohl glaube ich, dass die Verarbeitungsmöglichkeiten von Menschen so komplex sind, dass man kaum 1 zu 1 schlussfolgern kann: Betreuung im Kinderzimmer nach der Geburt = Traumatisierung für ein ganzes Leben. Wenn ich mir meine Geschwister und Klassenkameraden und all die Menschen meines Alters angucke, dann gibt es riesige Unterschiede darin, wer wie sein Glück gefunden oder nicht gefunden hat. Es müssen folglich sehr viel mehr Faktoren eine Rolle spielen, als nur die Erfahrungen unmittelbar nach der Entbindung. Offenbar ist auch bedeutsam, wie ich ein solches Ereignis lebensgeschichtlich bewerte. Wenn man – wie du schreibst – glaubt, „dass das nie wieder gut zu machen ist“, dann besteht die Gefahr, dass das Leben dir in dieser Überzeugung Recht gibt, dann wird dein Verstand eifrig Erfahrungen sammeln, um zu beweisen, dass diese These stimmt. Hilfreich wäre, das Erfahrene neu zu bewerten. Könntest du nicht auch schlussfolgern: Ich bin so stark und so widerstandsfähig, dass ich auch mit diesen frühkindlichen Erfahrungen zu einem lebensmutigen Erwachsenen herangewachsen bin?
Dass du das heilen und zu so einer Einstellung finden kannst, wünscht dir Uta
„dann besteht die Gefahr, dass das Leben dir in dieser Überzeugung Recht gibt, dann wird dein Verstand eifrig Erfahrungen sammeln, um zu beweisen, dass diese These stimmt.“
Ja, das stimmt. Wobei ich nie so ein negativer Mensch war. Aber bei mir scheint in letzter Zeit einiges „hochzukommen“ und dein erster Artikel zu dem Thema hat da anscheinend etwas angerührt in mir, womit ich mich jetzt erstmal befassen muss. Das war mir vorher nie bewusst bzw. hatte ich keine Probleme damit, außer dass ich es schlichtweg doof fand, wie die Geburt und die Zeit danach damals geregelt war. Ich habe mir Hilfe geholt, damit mich dieses Thema eben nicht dauerhaft beeinträchtigt, nur merke ich, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, an dem ich entspannt damit umgehen kann.
Danke für deine ausführliche, liebe Antwort!
Dana
Liebe Uta. Mich hat der Artikel auch sehr berührt! Als mein Vater im September 1974 vor die Scheibe trat und man ihm sein Kind zeigen wollte, rief er sofort aus: „Das ist nicht meine Tochter!“ Und er hatte tatsächlich recht, die Schwester hatte die Babys vertauscht… Beim zweiten Versuch sagte er: „Ja, das ist meine Tochter!“ Wie konnte er das nur wissen? Ich mag diese Geschichte, sie verbindet mich so unheimlich mit ihm. Ich wurde in der DDR geboren und ich bin niemandem böse, ich bin fest davon überzeugt, dass man damals nur Gutes wollte und die Schwestern sehr liebevoll zu den Babys und Müttern waren. Viele Mütter waren sicher auch dankbar für die Entlastung…
Trotzdem habe ich für die Geburt meines Kindes einen anderen Weg gewählt. Geboren wurde mein Sohn in der Klinik (der Papa war selbstverständlich dabei) – aber für mich war immer klar, keine Tasche auspacken, nicht das Zimmer beziehen, sondern nach dem vierstündigen Mindestaufenthalt nach der Geburt nach Hause fahren. Die Schwestern ließen mich spüren, dass sie das nicht gut fanden… Wir fanden das sehr richtig und ich bin dankbar für die vielfältigen Möglichkeiten, die wir Mütter heute – vor allem Dank der Hebammen und engagierten Kinderärzte – haben. So konnte selbst die Gelbsucht meines Sohnes zu Hause behandelt werden. Es ist dieses Urvertrauen, das ich habe: alles wird gut!
Liebe Anne, wie berührend! Bei Säuglingen ist es ja wirklich nicht einfach, sie zu unterscheiden. Dass dein Vater sofort eine Verbindung bzw. zuerst eine Nicht-Verbindung gespürt hat, ist beeindruckend. Wie schön, mit so einer Geschichte durchs Leben zu gehen. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast. Herzliche Grüße, Uta
Dieses Interview hat mich berührt und mich neugierig gemacht. Ich habe das Gespräch zu meiner Mama gesucht…
Ich bin 1986 geboren. Meine Mama hat mir gesagt, dass ich ihr nach der Geburt gezeigt wurde und dann musste ich erstmal weggebracht werden. Ich war überreif und hatte das sog. Kindspech. Nach dem alles im Lot war, hat mich meine Mama nach 2 Tagen wieder gesehen und ich wurde ihr alle 4 Stunden zum füttern gebracht. In der Zeit auf der Kinderstation hat mich meine Mama nicht gesehen, sagte sie. Auch das füttern erfolgte nicht durch sie.
Die Beziehung zwischen meiner Mama und mir ist nicht sehr innig. Ich kenne es nicht anders und empfinde es als normal. Ich bin dankbar, dass Sie mir das Leben geschenkt hat. Ich liebe und respektiere sie.
Den Zustand unserer Verbindung führe ich jedoch nicht darauf zurück, dass ich die ersten Stunden bzw. Tage nicht bei ihr verbrachte.
Nicht die ersten Stunden und Tage sind meines Erachtens nicht allein von besonderer Bedeutung für unsere Entwicklung, sondern auch die ersten Lebensjahre. In dieser Zeit entstehen die Konditionierungen, die bestimmen wie wir uns selbst wahrnehmen und wie wir die Realität für uns interpretieren. Neben unseren Eltern gibt es auch noch andere Menschen und Faktoren, welche über unsere persönliche Prägung entscheiden.
Egal in welchem Alter wir sind, wir sammeln Erfahrungen, die sich auf unser Leben auswirken.
Der Gedanke passt nicht in mein System, dass lediglich die Tatsache wie mit mir direkt nach der Geburt umgegangen wurde bzw. Meine Mama und ich kein inniges miteinander hatten, dafür verantwortlich sein soll, welcher Mensch aus mir wird bzw. Geworden ist.
Gleichzeitig bin ich natürlich dankbar, dass sich die Verfahrensweise bezüglich des Kontaktes Mutter und Kind nach der Geburt weiterentwickelt hat und der Individualität und Bedürfnisse jeder Mama und ihres Kindes Raum zur Entfaltung gegeben wird.
Mit der Geburt meines Kindes irgendwann werde ich meinen Lebenssinn „Mama sein“ leben und nach dem hier erfahrenen Umständen noch glücklicher sein.
Danke für die Weitergabe dieser Erfahrungen.
Das Gedicht an ihre Enkelin Rosa Frau Meyer hat mich zu Tränen gerührt. Es ist wunderschön.